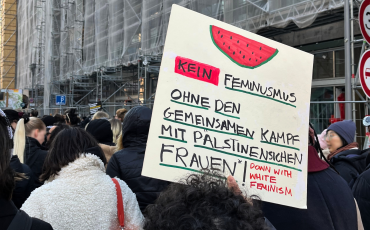Teil drei unseres historischen Abrisses: Aus israelischer Perspektive schien die Besitznahme der im Juni-Krieg eroberten Gebiete zunächst eine Erfolgsgeschichte, zwischen den Gebieten dies- und jenseits der Grünen Linie gab es regen Austausch. Die politische Elite sprach von „aufgeklärter Besatzung“ – und verkannte das paternalistische Wesen ihrer Fremdherrschaft. Widerstand ließ nicht lange auf sich warten.
Die Wochen nach dem Juni-Krieg waren in Israel von extremer Euphorie geprägt. Die existentielle Bedrohung war einem Gefühl der Überlegenheit und der unbegrenzten Möglichkeiten gewichen – schließlich hatte das kleine Land am Mittelmeer innerhalb weniger Tage sein Herrschaftsgebiet um ein Vielfaches vergrößert.
Die Umsetzung der Besatzung wurde in Israel in den Wochen und Monaten nach dem Krieg als Erfolg eingestuft. Speziell in Jerusalem ließ ein oberflächlicher Blick auf eine vielversprechende Koexistenz zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern schließen. Israelis frequentierten zuhauf die arabischen Restaurants der Altstadt und des Gebietes außerhalb des Damaskus-Tors, während palästinensische Jugendliche Jobs im Westen fanden. Doch schon in diesen Anfangstagen, bevor die Gewalt zum Alltag wurde, hatte das Miteinander klare Grenzen. Laut einer Studie des Stadtrats von Jerusalem lehnten es mehr als 50% der jüdischen Israelis in Jerusalem ab, ihre Kinder auf eine gemischte jüdisch-arabische Schule zu schicken. Neun von zehn Personen waren der Meinung, dass Juden im palästinensischen Ostteil wohnen dürften, während sechs von zehn umkehrt den Palästinensern das Recht verwehrten, im Westteil zu wohnen.
Tausende Israelis besuchten in den Folgemonaten die besetzten Gebiete, etwa die Strände von Gaza, die Grabstätten Abrahams in Hebron und Rachels am Rande Bethlehems oder die Märkte und Restaurants von Ramallah. Berichte an Verwandte im Ausland zeichnen ein verklärendes, romantisierendes Bild des „eigentlichen Eretz Israel“.
Auch die Wirtschaft erlebte einen Aufschwung, der einerseits dem neuen Optimismus der jüdisch-israelischen Bevölkerung und andererseits der forcierten ökonomischen Verflechtung Israels mit den besetzten Gebiete zugunsten der Besatzungsmacht geschuldet war: Nicht zwangsläufig die Kaufkraft, aber die Kauflust stieg aufgrund der weniger bedrohlichen Situation Israels. Auch die jüdische Zuwanderung nahm 1967/68 wieder deutlich zu. Parallel hierzu kurbelten Palästinenser*innen aus den besetzten Gebieten als billige Arbeitskräfte die Wirtschaft an. Nicht zuletzt entstand mit Gaza, Ostjerusalem und dem Westjordanland ein neuer Absatzmarkt für israelische Produkte.
Verpasste Chancen zur friedlichen Lösung
Das eingangs beschriebene Hochgefühl vernebelte den Blick vieler israelischer Entscheidungsträger*innen auf die Potentiale, welche die neue Position der Stärke in Bezug auf nachhaltige Vereinbarungen mit den arabischen Nachbarn und der palästinensischen Bevölkerung mit sich brachte. Der palästinensische Politiker Anwar Khatib fasste noch im selben Jahr die Auswirkungen des Juni-Kriegs auf das regionale Mächtegleichgewicht so zusammen: Vor dem Krieg weigerten sich die arabischen Staaten und Politiker*innen, Israels Existenz, „und sei es nur das Gebiet um Tel Aviv“, anzuerkennen. Nach dem Krieg hätten sie nicht nur Israel als Staat in der Region anerkannt, sondern auch die Notwendigkeit einer friedlichen Lösung des Konflikts. Für die israelische Regierung schien Frieden angesichts der eigenen Stärke nicht (mehr) unmittelbar dringlich. Belege für diese Wahrnehmung sind die geheimen Treffen zwischen israelischen Politikern und König Hussein von Jordanien, der nach Einschätzung des israelischen Ministerpräsidenten Levi Eschkol ernsthafte Bereitschaft an einem israelisch-jordanischen Friedensvertrag zeigte und dennoch auf taube Ohren stieß.
Doch der Reihe nach: Die israelische Exekutive hatte in den Wochen nach Kriegsende keinen kohärenten Plan für den Umgang mit den besetzten Gebieten. Ein Zitat von Eschkol steht sinnbildlich für den damals vorherrschenden Aktionismus ohne klare Linie: „Erstens: Ich weiß nicht, was ich will. Zweitens: Ich würde gerne etwas tun.“ Konkurrierende, teils militärische, Institutionen und Kommissionen entwarfen unterschiedliche Szenarien für den Umgang mit den besetzten Gebieten. Dabei wurden sowohl ein palästinensischer Staat als auch eine Re-Integration der Gebiete westlich des Jordans in das jordanische Königreich diskutiert. Die Pläne wurden verworfen, schließlich stellten die besetzten Gebiete, die unter Militärverwaltung standen, für die jungen Generäle eine Möglichkeit dar, eine Machtbasis vis-à-vis des politischen Establishments aufzubauen. Ihnen war nicht an einer Aufgabe der Gebiete und dem hiermit gewonnenen Einfluss gelegen.
Doch auch in der Regierung dominierte die Ansicht, die „Kriegsbeute“ nicht aufzugeben. Bereites am 12. November verschwand die Grüne Linie von offiziellen israelischen Karten. An ihre Stelle rückte die Waffenstillstandslinie vom 10. Juni 1967. Was Jerusalem anging, so waren sich Eschkol und seine Mitstreiter einig, dass die Stadt aufgrund der politischen und religiösen Bedeutung nicht wieder geteilt werden dürfe. Der Prozess der völkerrechtswidrigen schrittweisen Annexion des palästinensischen Ostteils und seiner rechtlichen Trennung vom Westjordanland nahm ihren Lauf.
Strategische, wirtschaftliche und religiös-emotionale Gründe für die Besatzung
Was das Westjordanland anging, so führte das Kabinett strategische (etwa die Kontrolle der Bergzüge und die Ausdehnung des an einer Stelle nur 12 km schmalen Staatsgebietes), wirtschaftliche (das fruchtbare Jordantal und die Grundwasservorkommen im zentralen Bergland) und religiös-emotionale (die Stätten des Alten Testaments und Kerngebiet von „Eretz Israel") Gründe an, die gegen einen Rückzug sprachen. Im Gegenteil begann die Regierung bereits 1967 Siedlungsvorhaben umzusetzen, nicht nur im Westjordanland, sondern auch auf den Golan-Höhen und der Sinai-Halbinsel. Bereits sechs Monate nach dem Krieg lebten 800 Personen in zehn Siedlungen. Im Wissen um den Verstoß gegen die vierte Genfer Konvention und aufgrund des internationalen Drucks, der in der UN-Sicherheitsrats-Resolution 242 im November 1967 seinen Ausdruck fand, wurden die Siedlungen von der israelischen Regierung als militärische Einrichtungen deklariert.
Gaza sollte ebenfalls unter israelischer Kontrolle bleiben. Die Präsenz hunderttausender Geflüchteter im Küstenstreifen stellte für die Exekutive und die Armee jedoch ein destabilisierendes Element dar. Von Eschkol genehmigte Programme mit dem Ziel, durch finanzielle Anreize einen Großteil der Geflüchteten zur Umsiedlung beziehungsweise Ausreise zu bewegen, hatten nur begrenzten Erfolg. Dasselbe galt für die Maßnahmen von Mordechai Gur, Militär-Kommandeur des Gazastreifens, der mit dem gleichen Ziel versuchte, die Lebenssituation der Bevölkerung in Gaza bewusst zu verschlechtern.
Nach 1967 war die Situation der Geflüchteten angesichts bedrückender Bilder wieder in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt. Mehrere Staaten und finanzstarken Einzelpersonen waren bereit, sich dem Problem anzunehmen. Aus Sicht des israelischen Historikers Tom Segev habe es 1967 durchaus angemessene Pläne und finanzielle Möglichkeiten gegeben, um die Geflüchteten aus den Flüchtlingsunterkünften herauszuholen und dauerhaft im Gazastreifen und im Westjordanland anzusiedeln. Wurde damals eine historische Chance verpasst? Die israelische Armee und Regierung rühmten sich zunächst für ihre „aufgeklärte Besatzung“: Politik und Militär hoben hervor, dass sie trotz des militärischen Sieges den Personen- und Warenverkehr zwischen dem Westjordanland und den arabischen Nachbarstaaten erlaubten. In ihrer Selbstwahrnehmung griff die Militärverwaltung kaum in den Alltag und die Bewegungsfreiheit der Menschen ein. In Wirklichkeit war dies jedoch nicht der Fall: Bereits im ersten Jahr der Besatzung veränderten sie den Lehrplan an palästinensischen Schulen, zensierten Schulbücher und politische Schriften, überwachten gewerkschaftliche Aktivitäten, setzten hörige Bürgermeister ein und bauten ein System von Kollaborateure zur Überwachung der Gesellschaft und Unterwanderung nationaler palästinensischer Bestrebungen auf.
Widerstand gegen die „aufgeklärte" Fremdherrschaft
Bereits im Sommer 1967 gab es ersten Widerstand seitens der palästinensischen Bevölkerung. In der vermeintlichen Vorzeigestadt Jerusalem streikten Schüler, Anwälte, Busfahrer und Ladenbesitzer gegen die Besatzungs- und Annexionspolitik Israels. Palästinensische Politiker boykottierten zudem den Stadtrat, Juristen weigerten sich am Stadtgericht zu arbeiten.
Dem gewaltfreien Widerstand folgten Sabotageakte und Terroranschläge: Im Oktober 1967 wurde ein Bombenanschlag auf das Zion-Kino vereitelt. Insgesamt verübten Palästinenser und Palästinenserinnen im ersten Jahr nach Beginn der Besatzung 687 Anschläge, die 175 israelische Menschenleben forderten, darunter 30 Zivilisten. Die Fatah um Yassir Arafat entwickelte sich zur schlagkräftigsten palästinensischen Organisation. Allein im Kampf um die im Jordantal gelegene Stadt Karameh fügte sie, im Verbund mit jordanischen Streitkräften, der israelischen Armee im März 1968 empfindliche Verluste zu und tötete 30 Soldaten.
Der Terrorismus gehörte in Israel bald zum Alltag, Ende der 1960er Jahre kamen Flugzeugentführungen als Terror-Instrument hinzu. Die Geisteshaltung vieler Israelis veränderte sich in Bezug auf die Bevölkerung der besetzten Gebiete; anstelle der Euphorie trat nach nur wenigen Jahren ein generelles Misstrauen gegenüber „den anderen“. Gleichzeitig stieg das Unbehagen angesichts der durch den militärischen Sieg entstandenen Situation. Segev schreibt hierzu: „Je mehr Zeit seit dem Krieg verstrich, desto mehr Israelis sehnten sich danach, der durch ihn geschaffenen Situation zu entrinnen, doch sie wussten nicht wie.“
Auf der politischen Ebene betrieb die Regierung fortan eine Politik der Verwaltung des status quo der Besatzung bei gleichzeitiger Schaffung von Tatsachen wie Siedlungen, militärischer Präsenz und Bewegungshindernissen. Zwar verurteilten einflussreiche Staatschefs, wie Charles de Gaulle, die Besatzung scharf, doch da die Hegemonialmacht USA keine Anstalten machte, gegen die Besatzung vorzugehen, konnte Israel seine Politik fortführen.
An einer diplomatischen Konfliktlösung mit den arabischen Nachbarstaaten oder der PLO zeigte die israelische Regierung in den Folgejahren kaum Interesse. Dabei führte sie immer wieder an, keinen Gesprächspartner zu haben. Tatsächlich hatten acht arabische Staatsoberhäupter am 1. September 1967 in Khartoum verkündet, Israel nicht anzuerkennen und daher auch mit israelischen Vertretern keine Verhandlungen zu führen und keinen Frieden zu schließen. Die Avancen des jordanischen Königs Hussein legen jedoch nahe, dass zumindest bilaterale Friedensabkommen möglich gewesen wären.
Auf der militärischen Ebene gewann der Inlandsgeheimdienst Schabak an Einfluss, das Besatzungsregime gewann an Brutalität. Dass das Land trotz seiner starken Armee und seiner Geheimdienste verwundbar blieb, zeigten nicht nur die Terroranschläge: Am 21. Oktober 1967 versenkten ägyptische Raketen den israelischen Zerstörer Eilat, 47 Israelis kamen dabei ums Leben. Nur sechs Jahre nach dem überwältigenden Sieg 1967 ließ sich die Armee von den syrischen und ägyptischen Streitkräften 1973 überraschen. Zwischen 2000 und 3000 Israelis starben in dem Krieg.
Wichtige Quelle für diesen Artikel war Tom Segevs Standardwerk „1967: Israels zweite Geburt", das an dieser Stelle wärmstens empfohlen wird. Die im Text erwähnten Studien und Zahlen werden in Segevs Buch angegeben.