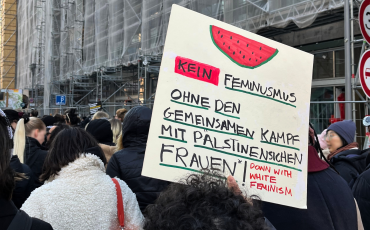Die Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina gilt als gescheitert. Die Alternative eines gemeinsamen Staates wird daher immer wieder diskutiert. Weil es dabei um unterschiedliche Ansprüche von Staatsbürgerschaft, Nation und Staat zwischen Israelis und Palästinensern geht, ist eine einheitliche Perspektive aber längst nicht in Sicht.
Die Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina ist mit der Wiederaufnahme der Vorgespräche für Friedensverhandlungen und dem zwanzigjährigen Jubiläum der Oslo-Abkommen wieder in aller Munde. Zwei Staaten für zwei Völker – das ist die offizielle Prämisse des „Friedensprozesses“. Dabei geht es für die palästinensische Bevölkerung um das, was Israel für seine jüdischen BürgerInnen schon verwirklicht hat – einen Staat, in dem die nationale Selbstidentifikation sich frei entwickeln kann.
Aus „realpolitischen“ Erwägungen gilt die Zwei-Staaten-Lösung demnach als die praktikabelste Option für einen Frieden in Nahost. Und das nicht erst seit den Oslo-Abkommen. Ideen und Pläne zur Teilung des Landes gab es viele: von der Peel-Kommission im Jahre 1937 über den Teilungsplan der Vereinten Nationen von 1947, bis hin zu heutigen zivilgesellschaftlichen Friedensinitiativen wie der „Genfer Initiative“ oder auch der „Arabischen Friedensinitiative“.
Doch so alt wie die Idee der Teilung in zwei Staaten ist auch die Idee eines gemeinsamen Staates für Palästinenser und Israelis im ehemaligen Mandatsgebiet Palästina. In dem Maße wie die eine als gescheitert gilt, erfährt die andere Option gerade wieder prominente Zuwendung. In den vergangenen Wochen haben sich dazu einige, vor allem intellektuelle Stimmen aus Israel, Palästina und den USA zu Wort gemeldet. Dabei ist diesen Beiträgen einzig gemein, dass sie ausgehend von einer Bestandsaufnahme der aktuellen politischen Situation nach möglichen Alternativen zu einer Zwei-Staaten-Lösung suchen.
Letztlich unterscheiden sich die einzelnen Vorschläge jedoch stark voneinander. Das liegt daran, dass sich darin jeweils unterschiedliche historische Bezüge mit diversen politischen Konzepten von Staatsbürgerschaft, Nation und Staat vermischen. Auch in ihrer Vision einer Alternative zur Zwei-Staaten-Lösung sind die verschiedenen Ansätze daher keineswegs identisch: So kursieren zur Zeit Ansätze einer Ein-Staaten-Lösung, einer bi-nationalen Lösung und einer Drei-Staaten-Lösung.
Ideengeschichte: „Kulturzionismus“
Die Idee eines geteilten Staates ist keineswegs auf den Mist der anti-zionistischen GegnerInnen Israels gewachsen, wie oft fälschlich behauptet wird. Im Gegenteil, sie ist Teil jener Bewegung, die die Gründung des Staates Israel maßgeblich vorangetrieben hat. Zu den prominentesten VertreterInnen dieser Bewegung gehörten Martin Buber, Albert Einstein, Hannah Arendt und Judah Magnes. Sie waren alle ebenso Anhänger der Idee einer „jüdischen Nation“ im Mandatsgebiet Palästina wie sie von der Notwendigkeit eines zwischen Juden und Arabern geteilten, bi-nationalen Staates überzeugt waren.
Diese „kulturzionistische“ Strömung hat in den zionistischen Diskursen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwar keine zentrale Rolle gespielt, war aber dennoch keineswegs ohne Einfluss. Im Kern ging es den Verfechtern dabei um die Unterscheidung zwischen Nation und Staat. Das bedeutet, dass die „Kulturzionisten“ zwar anerkannten, dass zwei unterschiedliche nationale Bestrebungen, die palästinensische und die jüdische, um Vorherrschaft im Mandatsgebiet fochten. Zwei Staaten für zwei Nationen hielten sie aber dennoch für den falschen Ansatz.
Buber, Magnes und Arendt waren vielmehr davon überzeugt, dass die jüdische Nation ihre universale humanistische Vision nur durch ein friedliches Miteinander mit den palästinensischen Arabern beweisen werden könne. Im Angesicht des wachsenden ethnisch-völkischen Nationalismus der deutschen Nationalsozialisten, der eine Gleichsetzung von Volk und Staat beinhaltete, wurde die euphorische Idee einer jüdischen Staatlichkeit nämlich mit Skepsis und Sorge betrachtet. Für Buber und Arendt, deren Leben durch die Nazi-Zeit massiv geprägt und tragisch verändert wurde, galt daher die Prämisse: kein Staat für keine Nation – oder ein Staat für zwei Nationen.
Grundlagen: bi-nationaler Staat und Ein-Staaten-Lösung
Auch die heutigen Diskurse, die eine Alternative zur Zwei-Staaten-Lösung bieten wollen, greifen die Differenz zwischen Nation und Staatlichkeit wieder auf. Während im Sinne der bi-nationalen Idee die Erhaltung des jüdischen und palästinensischen Nationalgedankens an erster Stelle steht, sieht die Ein-Staaten-Lösung die Auflösung eben jener nationalen Denkstrukturen vor; ein post-nationaler demokratischer Staat für alle, mit gleichen liberalen StaatsbürgerInnen-Rechten steht hier im Mittelpunkt.
VertreterInnen der bi-nationalen Idee gehen dabei von der Existenz eines palästinensischen und israelischen Bedürfnisses zur nationalen Selbstbestimmung aus. Dieses Bedürfnis soll in Form von föderalen Strukturen und Quoten festgelegt werden, um die nationale Sprache, nationalen Feste, Symbole und Traditionen für beide Gruppen zu schützen. Eine einfache Überstimmung durch Mehrheitsentscheidungen soll durch die Festlegung bestimmter Gruppen-Rechte und ein föderales System der Kontrolle und des Ausgleichs verhindert werden.
In einem bi-nationalen Staat wären die Posten zwischen Israelis und PalästinenserInnen zudem gleichwertig verteilt – und deren Stimmen gleich viel wert. Die Legitimität des nationalen Anspruches auf das gleiche Land stünde nicht in Frage – sie wäre vielmehr Grundlage für einen politischen und demokratischen Aushandlungsprozess, nicht Teil eines Wettkampfes um Territorium und Ressourcen. Ein bi-nationaler Staat könnte daher sogleich Heimat der jüdischen Nation wie auch des palästinensischen Volkes sein. Alle wären frei, nach Belieben zu siedeln, und keine Grenze würde eine Umsiedlung in anderes Territorium mehr nötig machen.
Die Idee der Ein-Staaten-Lösung dagegen lehnt nationale Bestrebungen als exklusiv und rassistisch motiviert ab. Stattdessen wird davon ausgegangen, dass volle und gleichwertige Rechte in einem Staat nationale Bestrebungen überflüssig machen. Ein demokratischer Staat für alle, getragen von seinen Bürgerinnen und Bürgern, die durch Wahlen und Aushandlungsprozesse ihre politischen VertreterInnen bestimmten, ist das politische Ziel der AnhängerInnen einer Ein-Staaten-Lösung.
Politische Krise – ohne Perspektive?
Die Ausgangsbasis der beiden Überlegungen sind dabei aber gleich: Israel und Palästina stecken politisch in einer tiefen Krise, nicht nur durch den anhalten Konflikt um Territorium, Staatlichkeit und Rechte. Auch die beiden Gesellschaften befinden sich in einer Sinnkrise bezüglich ihrer nationalen Identität und Staatlichkeit. Die durch Oslo auszuhandelnde Zwei-Staaten-Lösung hat zudem nicht zu einer Lösung des Konfliktes beigetragen, sondern ihn perpetuiert: es hat eine Aushandlung der wichtigsten Konfliktpunkte vertagt und die einseitige Landnahme durch Israel in der Westbank und Ost-Jerusalem verschärft.
Gleichzeitig hat eine territoriale Entgrenzung der nationalen Idee stattgefunden: Über eine halbe Million israelische StaatsbürgerInnen siedeln in dem Land, das entsprechend aller Teilungs-Abkommen eigentlich zu einem palästinensischen Staat gehören sollte. Für die israelischen SiedlerInnen in Palästina gilt israelisches Zivilrecht, während für die dort lebenden PalästinenserInnen israelisches Militärgesetz gilt. In Israel leben zudem über 1,5 Millionen PalästinenserInnen. Diese sind formal zwar BürgerInnen des Staates Israel, verstehen sich aber selbst als Teil der palästinensischen Nation. Als nicht-jüdische Bevölkerung werden sie in Israel auf unterschiedliche Weise diskriminiert und sind für manche israelische Politiker gar Gegenstand von Transferplänen.
Im Jahre 2013 sind Israel und Palästina gesellschaftlich und territorial trotz aller Teilungspläne mehr miteinander verbunden, als sich beide Gesellschaften in ihrer Abgrenzungs-Rhetorik eingestehen wollen und können.
Kollektive Traumata
Doch Kritik an den Konzepten zu einem bi-nationalen Staat oder zur Ein-Staaten-Lösung gibt es freilich genug – und viele Zweifel und Einwände. Viele jüdische Israelis zum Beispiel begreifen einen Staat, der per Definition nicht mehr „jüdisch“ wäre, als Gefahr – auch wenn eine arabische Mehrheit und eine jüdische Minderheit dann gemeinsam BürgerInnen eines großen demokratischen Staates wären. Föderale Regelungen und Quoten hin oder her: ein demokratischer Staat wäre für sie ein Staat mit einer jüdischen Bevölkerungsminderheit.
Was es dabei bedeuten würde, eine „jüdische Minderheit“ in einem demokratischen Staat zu sein, ist schwer vorherzusagen. Das müsste Teil eines umfassenden palästinensisch-israelischen Aushandlungsprozesses werden. Aber es schürt Ängste, die nicht einfach zu ignorieren und mit Floskeln über demokratische Entscheidungsfindung und Minderheitenrechte aufzulösen sind: denn ein Konflikt, der so lange währt und in Form von Vertreibung, Kriegen, Terror, Unterdrückung und vielen Traumata fest im kollektiven Gedächtnis beider Gesellschaft verankert ist, löst beiderseits nicht nur Hoffnungen auf Frieden und Versöhnung aus.
Auch bleibt die Frage unbeantwortet, wie „jüdisch“ in einem gemeinsamen Staat zu verstehen wäre – eine Frage, die zwar auch im Staat Israel bis heute kontrovers diskutiert wird, dort aber über demokratische Prozesse immer wieder Gegenstand von Aushandlung ist. Die Idee, dass das „jüdische“ Element prägend für die ganze israelische Nation sei, greift dabei aber zu kurz und ist gefährlich. So bekunden viele arabische Stimmen bis heute, man hätte mit dem Judentum als Religion kein Problem, nur mit dem Zionismus als dessen national-politische Territorialbewegung. Doch der Verweis auf die freie Ausübung von Religion ist noch kein Friedensangebot und Türöffner für eine Ein-Staaten-Lösung.
Denn dieser Fokus auf religiöse Rechte und Pflichten missachtet unter anderem, dass es seit 1948 einen Staat Israel gibt, in dem sich ein heterogenes und selbstbewusstes nationales Selbstverständnis entwickelt hat. Die hebräische Sprache, die hebräisch-israelische Literatur und Musik, die Idee der Kibbutzim und auch die Stadt Tel Aviv – sie sind kein Ausdruck eines religiösen, sondern eines nationalen Selbstverständnisses und dabei auch wichtiger Teil jüdisch-israelischer Identität, die sich entlang vieler Identifikationslinien vollzieht.
Ein Staat für Israelis und Palästinenser, in dem PalästinenserInnen eine Mehrheit darstellen würden – allein die Vorstellung löst für viele Israelis daher Existenzängste und das Gefühl der Bedrohung durch Vernichtungsphantasien und Racheakte von palästinensischer Seite aus. Die Hamas beispielsweise befeuert solche Ängste dadurch, dass sie demographische Prognosen dahingehend ausnutzt, palästinensische/arabische Vormacht in einem geteilten Staat zu beanspruchen. Es wäre verheerend, diese Ängste zu ignorieren. Denn die Aussicht auf einen gemeinsamen Staat, ob bi-national oder nicht, untergräbt nicht nur die Idee des politischen Zionismus, sondern auch das heutige Selbstverständnis der staatlichen Institutionen und der meisten Israelis: dass Israel sowohl demokratisch, als auch jüdisch sein kann.
Paradoxe Aussichten
Doch dieser viel diskutierte, fast unauflösbare Gegensatz zwischen „demokratisch“ und „jüdisch“ befördert paradoxerweise auch die Idee eines gemeinsamen Staates. Bei immer mehr BeobachterInnen des Konflikts setzt sich dabei zunehmend der Eindruck durch, dass zwar noch immer eine Zwei-Staaten-Lösung verhandelt, dabei aber eine Ein-Staaten-Lösung schon längst implementiert wird. Und territoriale Realität ist. Die Oslo-Abkommen haben somit einen wichtigen Beitrag zur jetzigen Situation geleistet: sie haben die politische Geographie der Westbank definiert und somit jene territoriale Aufteilung Palästinas ermöglicht, die jetzt die Grundlage für unterschiedliche Ansprüche auf Land, Ressourcen und Zuständigkeit darstellt. Die israelischen Siedlungen, Straßen, Checkpoints und die dazwischen gelegenen kleinen Inseln palästinensischer Autonomie sind so Wirklichkeit geworden.
Ergebnis ist eine Situation, in der rund 350,000 israelische StaatsbürgerInnen mit vollen Bürgerrechten und -pflichten in palästinensischem Gebiet leben (plus knapp 200,000 weiteren im annektierten Ost-Jerusalem). Die dort lebenden PalästinenserInnen haben aber kaum Rechte und viele Pflichten gegenüber einem Regime, welches sie täglich als repressiv und kolonial erfahren und das sie politisch nicht repräsentiert.
Mittlerweile erkennen auch viele Israelis an, dass diese diskriminierende Situation alles anderes als „demokratisch“ ist, wobei aus dieser Erkenntnis unterschiedliche Ideen und Praktiken für eine „Lösung“ abgeleitet werden.
Ein besonders dreister Vorschlag kam zuletzt von Danny Danon, dem stellvertretenden Verteidigungsminister der amtierenden israelischen Regierung: Israel müsse die Oslo-Verträge annullieren und mit Jordanien und Ägypten über eine Übernahme der PalästinenserInnen in der Westbank und Gaza verhandeln. Vereinfacht heißt das: Die Verantwortung für Gaza soll an Ägypten übergeben werden und Israel behält die Siedlungen in der Westbank, abzüglich der palästinensischen Bevölkerung, die an Jordanien übergeben werden soll. Eine perfekte Ein-Staaten-Lösung soll das sein – für Israel. Ein jüdisch-israelischer Staat, vom Mittelmeer bis zum Jordan, in dem Israel Territorium behält, seine Verantwortung für die ungewollte palästinensische Bevölkerung aber einfach an Jordanien und Ägypten abtritt. Keine demokratische Lösung – aber eine pragmatische, wie Danon befindet.
Auch von palästinensischer Seite wird mit verschiedenen Versionen der Ein-Staaten-Lösung gespielt. Dabei gilt die Zwei-Staaten-Lösung ebenfalls weithin als gescheitert. Israel wird zudem dafür kritisiert, sich dennoch weiter zu zwei Staaten zu bekennen, um so ungehindert Fakten zu schaffen, die eine gerechte Lösung unmöglich machen. Aus der palästinensischen Zivilgesellschaft werden daher immer mehr Vorschläge laut, die (semi)staatlichen Strukturen aufzulösen. So soll der Welt die Scheinheiligkeit der vermeintlichen palästinensischen Autonomie vor Augen geführt werden – um anschließend die volle zivile und militärische Fürsorge für ungefähr 4 Millionen PalästinenserInnen an Israel zu übertragen. Israel stünde dann vor der Entscheidung, die Besatzung Palästinas weiter aufrecht zu erhalten – oder die palästinensische Bevölkerung zu gleichen und freien BürgerInnen eines Staates zu machen.