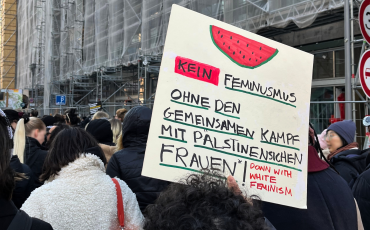Als junger Arzt in Gaza betreut Amro Hamada Patient:innen mit Nierenversagen im Endstadium. Abgeschnitten von der notwendigen Versorgung, sterben viele von ihnen still und leise.
Wer in Gaza krank wird, sieht sich mit einem Gesundheitssystem konfrontiert, das selbst ums Überleben kämpft. Wer sich die horrenden Kosten für die Autofahrt ins Krankenhaus nicht leisten kann, muss oft weite Strecken zu Fuß auf nahezu unpassierbaren Straßen zurücklegen oder sich von anderen tragen lassen, um überhaupt einen Arzt:Ärztin aufzusuchen. Tritt nachts ein lebensbedrohlicher Notfall ein, muss man unter Umständen bis zum nächsten Tag abwarten – nicht nur auf die ersten Sonnenstrahlen, sondern auch auf die vergleichsweisen sicheren Morgenstunden – denn wer sich zu früh aufmacht, läuft Gefahr, gar nicht erst anzukommen.
Doch die Diagnose ist nur der Anfang. Was einst ein Schritt zur Heilung war, ist heute oft ein Countdown. Selbst wenn die Krankheit behandelbar ist, kann die Umgebung eine Genesung unmöglich machen. Die Versorgung, die man erhält, hängt von den wenigen Expert:innen vor Ort ab, sowie von den noch verfügbaren Behandlungsmethoden und medizinischen Geräten. Praktisch jedes Krankenhaus hier wurde bombardiert. Die Apotheken sind leer.
Zunächst als Medizinstudent und inzwischen als junger Arzt in Gaza habe ich mehrere Monate damit verbracht, mit meinen Kolleg:innen die Auswirkungen des Krieges auf einige der am stärksten gefährdeten Patient:innen des Gazastreifens zu untersuchen. Ein besonderer Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf Patient:innen mit terminaler Niereninsuffizienz, die eine Hämodialyse benötigen. Vor dem aktuellen Krieg waren laut Statistik rund 1.000 und 1.500 Menschen in Gaza auf einen kontinuierlichen Zugang zu Dialysediensten angewiesen. Für diese Patient:innen standen 182 Dialysegeräten in sieben Zentren zur Verfügung: Al-Shifa Medical Complex, Rantisi Children’s Hospital und Al-Quds Hospital, alle in Gaza-Stadt; Noura Al-Kaabi Dialysis Center in Nord-Gaza; Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir Al-Balah; Nasser Medical Complex in Khan Yunis und Abu Youssef Al-Najjar Hospital in Rafah.
Schon vor dem Krieg war der Alltag dieser Patient:innen alles andere als stabil. Armut und Arbeitslosigkeit prägten ihr Leben. Viele berichteten von einer insgesamt schlechten Lebensqualität. Die meisten Dialysegeräte liefen über die empfohlene Betriebszeit hinaus. Es herrschte ein ständiger Mangel an Vorräten und Medikamenten. Weniger als einen Monat vor Kriegsbeginn gingen den Zentrallagern des Gesundheitsministeriums die medizinischen Verbrauchsmaterialien – lebensnotwendige und unersetzliche Artikel mit begrenztem Nutzen – für die Dialyse aus; darunter Blutfilter, Kanülen und Blutschläuche. Die unhygienischen Bedingungen in Gaza, die teilweise auf die extreme Armut zurückzuführen waren, trugen zu einer hohen Zahl an Fistelversagen bei – der chirurgischen Verbindung zwischen Arterie und Vene, über die Ärzt:innen die Kanüle, den dünnen Schlauch, der bei der Dialyse verwendet wird, einführen.
Zwischen Hoffnung und Erschöpfung: Dialysepatient:innen kämpfen ums Überleben
Doch mittlerweile ist das Leben der Dialysepatient:innen zu einem ständigen Balanceakt zwischen Hoffnung und Erschöpfung geworden. Die meisten dieser Patient:innen benötigen Medikamente – Erythropoese-Stimulatoren, Phosphatbinder und Blutdrucksenker –, die seit dem völligen Zusammenbruch des Gesundheitssystems in Gaza sehr knapp sind. Eine nierenfreundliche Ernährung ist selbst unter besten Bedingungen eine Herausforderung. Doch angesichts der zunehmenden Hungersnot ist sie praktisch unmöglich geworden: Die Preise für Grundnahrungsmittel sind auf das Hundertfache ihres normalen Wertes gestiegen.
Ein gesunder Lebensstil ist entscheidend für die Bewältigung chronischer Nierenerkrankungen und der häufigen Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes. Doch mittlerweile sind selbst die Gesündesten unter uns erschöpft und ausgelaugt. Kochen bedeutet oft das Einatmen giftiger Dämpfe von brennendem Plastik oder Holzresten. Selbst für die Beschaffung von unsauberem Wasser muss man stundenlang in langen Schlangen warten, der Schlaf ist gestört, Drohnen schwirren Tag und Nacht über den Köpfen. Und die einzige Form der Bewegung, die einem bleibt, ist das Rennen um sein Leben.
Viele Patient:innen haben Angehörige und Betreuende verloren, was sie noch tiefer in Isolation und Verzweiflung stürzt. Vor allem Menschen mit Nierenversagen im Endstadium benötigen regelmäßige Dialysesitzungen, für die es nur noch vier überfüllte und schwer erreichbare Zentren gibt. Die Folge ist, dass diese Patient:innen – wie so viele andere in Gaza – still und leise sterben.
Als ich in Gaza aufwuchs, erlebte ich hautnah, wie systemische Herausforderungen individuelles Leid hervorrufen – von den finanziellen Engpässen und materiellen Entbehrungen durch die israelische Blockade bis hin zu den verheerenden Auswirkungen der vielen Kriege, die ich erlebt habe. Als ich mich 2018 an der Al-Azhar-Universität in Gaza-Stadt einschrieb, beschloss ich, Medizin zu studieren. Ich sah in der Pflege von Kranken eine Chance, dieses Leid zu lindern. Doch im Laufe meines Studiums erkannte ich, dass soziale und medizinische Forschung ein wirksames Mittel zum Aufbau kollektiver Stärke ist. Es ging nicht nur darum, Ungerechtigkeit zu dokumentieren, sondern Menschen – insbesondere denjenigen, die am meisten leiden – zu ermöglichen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen, ihre Geschichten zu teilen und dauerhafte Veränderungen anzustreben.
Nie war dieses Projekt dringlicher – oder schwieriger – als in den letzten achtzehn Monaten. Jede Familie hat ihre eigene Tragödie erlebt. Meine Eltern, meine vier Geschwister und ich wurden mehr als fünfzehn Mal vertrieben. Mit jeder Zwangsumsiedlung ist es, als würden wir einen Teil von uns selbst verlieren. Eines Tages griffen die israelischen Streitkräfte das Gebäude an, in dem wir Schutz suchten. Meine Schwester verletzte sich bei unserer Flucht an der Hand und dem Fuß. Nach unserer Flucht fanden wir Schutz in einem alten Einfamilienhaus von 1956 mit einem kleinen Garten. Im Laufe des Krieges, wurde unser Elternhaus in Al-Zahra City fast komplett zerstört. Wir mussten unsere alte Nachbarschaft mehrmals verlassen– und kehrten am Ende wieder dorthin zurück. Jetzt ist das Haus ständig einsturzgefährdet, besonders bei Luftangriffen.
Ärzt:innen in Gaza waren schon immer enormen Belastungen ausgesetzt
Unterwegs habe ich Dinge gesehen, die niemand sehen sollte. Einmal wurde ein junges Mädchen nach einem Bombenangriff auf ein Nachbarhaus durch die Luft geschleudert und landete bei uns. Sie erlitt dabei zahlreiche Verletzungen: Die Couch, auf der sie geschlafen hatte, flog mit und dämpfte einen Teil des Aufpralls, was ihr wahrscheinlich das Leben rettete. Ein anderes Mal, während einer unserer Fluchten in eine abgelegene Gegend, war ich mit meiner Mutter unterwegs. Wir wollten Essen holen, als in der Nähe eine Panzergranate einschlug und einen Mann entzweiriss. Sein Oberkörper lag vor mir. Der Rest war entweder weggesprengt oder in den Trümmern zerschmolzen. Ein paar Wochen später verblutete mein Onkel Hosam Hamada – Gazas leitender Pathologe – innerhalb von zwei Nächten, als er während einer langwierigen Belagerung nach einem sicheren Ort für seine Familie suchte.
Sechs Jahre lang kämpfte mein anderer Onkel Hisham AbuAqlain gegen Lungenkrebs. Seine Behandlung wurde wiederholt durch die erniedrigenden Hürden des israelischen Apartheidsystems und des Genehmigungsregimes behindert. Er musste für seine Behandlungen zwischen Gaza und Ostjerusalem hin- und herreisen, ohne dass ihm dazwischen ausreichend Zeit für eine angemessene Überwachung oder Betreuung blieb. Kurz nach seiner Diagnose im Jahr 2019 erfuhr er, dass er aufgrund mangelnder Nierennachsorge irrtümlicherweise eine Chemotherapie erhalten hatte, obwohl er gefährlich hohe Kreatininwerte und schwere Ödeme aufwies. Dies führte zu weiteren Nierenschäden und schließlich zur Notwendigkeit einer regelmäßigen Dialyse.
Erhöhte Kreatininwerte – ein Marker für eine eingeschränkte Nierenfunktion – hatten bereits auf eine schwere Nierenschädigung hingewiesen. Doch die fragmentarische Behandlung machte es nahezu unmöglich, angemessen zu reagieren. Der Zugang zu Krankenhäusern in Ostjerusalem erfordert ein langwieriges und unvorhersehbares Ausreisegenehmigungsverfahren durch die israelischen Behörden. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zeitweise drastisch – insbesondere in Kriegszeiten oder bei Eskalation oder wenn die Erlaubnis zur Begleitung eines Angehörigen verweigert wurde.
Letztes Jahr wurde er, nachdem er sechs Monate Krieg in Gaza erlebt hatte, zur Behandlung in die Türkei evakuiert. Dort verbrachte er mehrere Monate ohne Zugang zu seiner Krebstherapie, da ihm die finanziellen Mittel fehlten. Doch diese Entbehrung ist kaum zu vergleichen mit dem, was er in diesem ersten halben Jahr im Gazastreifen erdulden musste. Nach seiner Zwangsumsiedlung in den Süden Gazas musste er oft kilometerweit laufen, um das Dialysezentrum im Al-Aqsa-Märtyrerkrankenhaus zu erreichen, wo er zwei einstündige Sitzungen pro Woche erhielt.
Auf dem Weg zum oder vom Krankenhaus lief er oft gefährlich nahe an Luftangriffen entlang, die in unmittelbarer Nähe stattfanden. In der Zwischenzeit musste er gänzlich auf seine Krebsmedikamente verzichten. Am 11. Juni erfuhr meine Familie, dass Hisham dieses Leben verlassen hat. Meine Mutter hatte seinen langen, ermüdenden Weg hautnah miterlebt. „Ich wünschte“, sagte sie mir, „ich wäre in seinen letzten Tagen da gewesen, um ihn zu unterstützen.“ Für die Menschen in Gaza ist selbst die Möglichkeit, Abschied zu nehmen, eine Art Luxus geworden.
Zwei von fünf Patient:innen sind in den letzten 18 Monaten aus Mangel an medizinischer Versorgung gestorben
Während alldem setzten meine Kolleg:innen und ich unsere Arbeit fort. Für eine aktuelle Studie arbeitete ich eng mit Hämodialysepatient:innen zusammen, um zu verstehen, wie sie diese schweren Bedingungen ertragen. Zunächst nahm ich an, dass Widerstandskraft, Routine oder familiäre Unterstützung den meisten Dialysepatient:innen in Gaza geholfen hätten, das Undenkbare zu überleben. Doch im Oktober 2024 erfuhr ich, dass die Gesamtzahl der Dialysepatient:innen derzeit bei etwa 850 liegt – eine weitaus geringere Zahl als vor dem Krieg. Viele Patient:innen, so dämmerte es mir damals, waren bereits gestorben.
Im Laufe der Studie stellten wir fest, dass immer mehr Namen zu unserer Patient:innenliste hinzukamen – Menschen, die nach Kriegsverletzungen oder einer Verschlechterung ihres zuvor beherrschbaren Gesundheitszustands eine Behandlung im Endstadium einer Nierenerkrankung benötigten –, während die von Menschen verursachte Katastrophe andere Dialysepatienten das Leben kostete. Im April berichtete das Gesundheitsministerium von Gaza, dass in den vergangenen 18 Monaten mehr als 400 solcher Patient:innen, etwa zwei von fünf im Gazastreifen, an mangelnder Versorgung gestorben waren.
Als die Studie abgeschlossen war, waren die Ergebnisse wenig überraschend, aber deshalb nicht automatisch auch weniger schockierend: Die verbleibenden Dialysezentren reichen nicht aus, um den Bedarf der Bevölkerung zu decken. Manche Patient:innen haben seit über hundert Tagen keinen Zugang zur Dialyse, was zu einer Ansammlung von Giftstoffen führt, die gesunde Nieren normalerweise ausscheiden würden. Ein oder zwei Sitzungen pro Woche reichen kaum aus, um den gefährlich hohen Harnstoffspiegel zu senken oder den Blutdruck effektiv zu kontrollieren. Die überlebenden Patient:innen haben durchschnittlich zehn Kilogramm abgenommen. Schon wenige Minuten in der verfallenen, zerstörten Notaufnahme des Al-Shifa-Krankenhauses, wo ich mein Praktikum mache, genügen, um zu erkennen, dass dies eine unheilbare Realität ist.
Der Tod ist nicht zu heilen. Ich sehe Menschen in die Augen, die die Notaufnahme betreten. Ich sehe die Angst um ihre Angehörigen in ihren Gesichtern. Ich sehe, wie verzweifelt sie hoffen, aber ich weiß auch, wie schnell die Kluft zwischen ihren Bedürfnissen und dem System, dem sie ihr Vertrauen schenken, wächst. Ich verbringe meine Schichten damit, das Elend zu bewältigen und mir eine rationale Lösung auszudenken, um alles zu beheben. Aber jedes Mal komme ich zum gleichen Schluss: Wir brauchen ein Wunder.
Doch es gab kein Wunder: Am Sonntag, dem 1. Juni, zerstörte das israelische Militär das Dialysezentrum Noura Al-Kaabi, das einzige im Norden des Gazastreifens, das wöchentlich mehr als 40 Patient:innen versorgte. Für diese Patient:innen ist meine Forschung weitgehend bedeutungslos geworden: Sie werden keinen Zugang mehr zu medizinischer Versorgung haben, keine Daten mehr analysieren, keine Geschichten mehr über ihre Widerstandsfähigkeit oder ihren Überlebenskampf schreiben. Viele von ihnen werden langsam sterben und jeder einzelne wird zu einer weiteren Zahl auf der wachsenden Metzgerrechnung des Völkermords in Gaza.
Dieser Text erschien auf Englisch zuerst in der New York Review of Books, am 24. Juni. Wir veröffentlichen den Text mit der freundlichen Genehmigung des Autors.