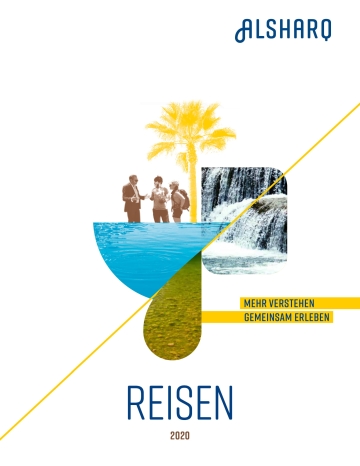Von Umm Kulthum bis Dalida: Eine Ausstellung im Pariser Institut du monde arabe rückt arabische Divas ins Rampenlicht. Sie zeigt ihre Kunst, ihren Einfluss – und fragt, ob sie wirklich so frei und emanzipiert waren, wie viele glauben.
Sie waren Heldinnen ihrer Zeit: Arabische Künstlerinnen wie Fairuz, Umm Kulthum oder Dalida prägen bis heute das kulturelle Gedächtnis der arabischsprachigen Welt. Ihre Lieder begleiten den Alltag der Menschen, es heißt: Der Morgen beginnt mit Fairuz, Umm Kulthum beendet den Tag. Als Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron 2020 den Libanon besuchte, war seine erste Station nicht der Präsident, sondern die Sängerin Fairuz. Bis heute fasziniert das Phänomen solcher Divas Jung und Alt.
Das Pariser Institut du monde arabe (IMA) widmete ihnen im März die Ausstellung „Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida“ (dt.: Divas, von Umm Kulthum bis Dalida). Der Anlass war das Festival Journées de l’Histoire (dt.: Tage der Geschichte) unter dem Motto „Heldinnen und Helden der arabischen Welt“. Bunte Stellwände erzählen von den Leben und Werken der bedeutendsten Sängerinnen, Schauspielerinnen und Tänzerinnen im goldenen Zeitalter der arabischen Popkultur von 1920 bis 1970. Damit Besucher:innen die Stimmen der Heldinnen auch hören können, hat die Bibliothek des IMA CDs und DVDs zusammengestellt. Online gibt es eine digitale Ausstellung.
Goldene Jahre, widersprüchliche Freiheit
Doch es geht um mehr als nur Pailletten und Glamour: Die Ausstellung hinterfragt, wie frei diese Ikonen in einer patriarchal geprägten Gesellschaft wirklich waren. Ein Zeitsprung: Das Phänomen der Divas entstand in den 1920er-Jahren in Kairo – zur Blütezeit der nahda (dt.: Renaissance), einer intellektuellen, kulturellen und sozialen Reformbewegung, die in Ägypten, Syrien und dem Libanon ihren Anfang nahm. Auch feministische Stimmen wurden lauter – etwa die des ägyptischen Frauenrechtlers Qasim Amin, dem „ersten Feministen Ägyptens“.
In der Periode zwischen 1920 und 1970 boomten auch Musik und Kino, vor allem in Ägypten. Während in der Politik zwar Männer regierten, dominierten Frauen die Kunstszene. Sie profitierten von neuen Medien wie Schallplatten, Radio und Film. Nilwood, das „Hollywood am Nil“, produzierte Filme mit starken Frauenfiguren, dramatischen Küssen und sinnlichen Tänzen. Ein neues Frauenbild wurde geschaffen: frei, mutig und selbstbestimmt. Die Künstlerinnen wurden zu Ikonen, gefeiert für ihr Talent und ihre Freiheit, verehrt wie Heilige. Doch ihr Alltag war geprägt von patriarchalen Strukturen.
Die Stimme des Libanon
Die Libanesin Fairuz, 1934 als Nouhad Haddad geboren, wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Als Teenagerin wurde sie in einem Chor entdeckt, später von Assi und Mansour Rahbani, einem libanesischen Komponisten-Duo, zum Erfolg geleitet. Assi wird sie später heiraten. Ihr Erfolg in den 1950er-Jahren trägt sogar dazu bei, dass sich das Zentrum der arabischen Musikszene von Kairo nach Beirut verlagert. Doch ihre Karriere war stark von Männern geprägt – ihr Ehemann, sein Bruder und ihr Sohn schrieben ihre Lieder und bestimmten, wo sie auftrat.
Dennoch setzte sie sich in einer von Männern geprägten Musikwelt durch, ohne sich politisch vereinnahmen zu lassen. Während des libanesischen Bürgerkriegs (1975–1990) blieb sie im Land, trat aber aus Protest nicht auf – und wurde gerade deshalb noch populärer. Ihre Lieder, gehört von Menschen aller Konfessionen, erzählen von Beirut, den Zedern und der Liebe zur Heimat. Das Forbes Magazine nennt sie den „ultimativen arabischen Star“. Für die Libanes:innen ist sie die „Botschafterin der Sterne“ und „die Stimme des Libanon“ – eine Stimme, die vereint. Wer im Libanon morgens das Radio aufdreht, hört sie wahrscheinlich.
Zwischen Erfolg und Einsamkeit
Das Schicksal der Sängerin Dalida zeigt die Kehrseite des Diva-Ruhms. Geboren 1933 in Kairo, italienischer Herkunft, wurde sie 1954 erst zu Miss Ägypten, dann zum Filmstar. Sie spielte den Vamp in Un verre, une cigarette (dt.: Ein Glas, eine Zigarette) von 1955, später die femme fatale in Filmen wie Le Masque de Toutankhamon (dt.: Die Maske des Tutankhamuns) von 1954 und L’Or du Nil (dt.: Das Gold des Nils) von 1955. 1977 feierte sie mit dem ägyptischen Volkslied Salma ya salama (dt.: Friede oh Friede) weltweit Erfolge. In Le sixième jour (dt.: Der sechste Tag) von 1986 verkörperte sie eine Wäscherin – und brach so gezielt mit ihrem glamourösen Image. Und sie traute sich, offen über tabuisierte Themen wie Abtreibung und psychische Gesundheit zu sprechen.
Doch hinter der starken Fassade litt sie an Depressionen, dem öffentlichem Druck, an Sexualisierung und an Einsamkeit – drei Menschen aus ihrem Umfeld hatten sich umgebracht. 1987 nahm auch sie sich in Paris das Leben. Es war ihr „unerträglich geworden“, schrieb sie in einem Abschiedsbrief. Ihr Körper wird noch heute sexualisiert: in Form einer Statue auf dem Pariser Hügel Montmartre. Ihre Brüste glänzen in einer helleren Farbe – das Berühren ist ein Ritual für Tourist:innen geworden.

Emanzipation und Engagement
Die Divas verändern die Popkultur. Sie brechen Tabus und schaffen ein neues Genre: frei, poetisch, politisch. Und ein neues Frauenbild: emanzipiert und engagiert. So wie die gefeierte Tänzerin Tahiyya Carioca (1915–1999), die „Marilyn Monroe der arabischen Welt“ – eine Legende des ägyptischen Tanzes. Angefangen hatte sie in einem Kabarett, später spielte sie in über 120 Filmen mit, darunter Shabab emraa (dt. Jugend einer Frau), der 1956 beim Filmfestival in Cannes gezeigt wurde.
Schon in den 1940er-Jahren kämpfte sie für soziale Gerechtigkeit, bewegte sich in linken Kreisen und versteckte den Offizier Anwar al-Sadat, der an einem Attentat gegen den ägyptischen Finanzminister beteiligt gewesen war. 1953 saß sie mehrmals wegen „kommunistischer Aktivitäten“ im Gefängnis. Und doch: Künstlerinnen wie sie lebten anders als viele Frauen ihrer Zeit – Tahiyya heiratete 14 Mal.
Die Divas als Teil des kulturellen Gedächtnisses
Kann man also von Emanzipation sprechen? Gaëlle Fenianos kommt aus dem Libanon und lebt seit 2021 in Frankreich. Ihrer Meinung nach sind „Emanzipation und Feminismus heute starke Begriffe – im historischen Kontext ist jedoch Vorsicht geboten. Für ihre Zeit waren sie es. Immerhin gehörten sie zu den ersten weiblichen Bühnenfiguren überhaupt“. Wenn Gaëlle ihre Heimat vermisst, hört sie ein Lied von Umm Kulthum, Warda oder Fairuz.
Die liefen schon im Radio ihrer Großmutter. „Damals interessierte ich mich aber noch nicht dafür“, sagt sie. Die Musik der Divas ist Teil des kulturellen Gedächtnisses und wird von Generation zu Generation weitergegeben. „Sobald man ein gewisses musikalisches Gespür entwickelt hat, wird man süchtig danach“, beschreibt Gaëlle. Die ägyptische Sängerin Umm Kulthum brachte die Menschenmenge sogar bis zur musikalischen Extase. Als sie am 3. Februar 1975 starb, folgte ihr ein enormer Trauerzug durch die Straßen Kairos, wie bei einem Staatschef. Mit ihr starb für viele die Hoffnung auf ein freies Ägypten.
Hier geht es zu einem Artikel, der das Leben von Umm Kulthum genauer behandelt.
Ein Erbe, das weiter klingt
Die meisten der Divas sind bereits verstorben, Fairuz tritt schon lange nicht mehr auf. Was bleibt, ist ihre Wirkung: „Zugleich real und irreal, stark und zerbrechlich. Sie verkörpern sowohl das kollektive Denken, als auch die persönliche Verletzlichkeit”, schreibt der französische Politiker und Kulturförderer Jack Lang im Ausstellungskatalog des IMA.
Heute prägen Namen wie Nancy Ajram, Elyanna, Haifa Wehbe oder Elissa den arabischen Pop. Laut Gaëlle ist dies aber „komplett losgelöst von der Musik der Diven. Sie sind ein Spiegel des neuen Zeitgeistes und kein Ersatz. Du wirst mich kaum dabei erwischen, wie ich diese neuen Songs höre“, sagt sie. Wenn sie ihren europäischen Freund:innen arabische Songs vorspielt, dann lieber von Fairuz oder Umm Kulthum: „Für Europäer:innen ist das exotisch, und ein Zugang zu unserer vielfältigen Kultur.“