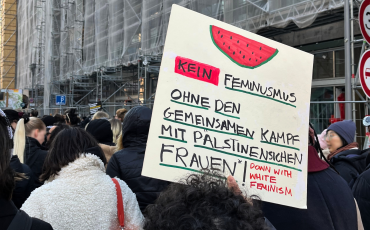Mina Jawad besuchte das Afghanistan-Festival von „Goethe im Exil“. Sie reflektiert über den Kampf von Künstler:innen zwischen Diaspora und Exil um die Kultivierung ihres kulturellen Erbes. Eine Geschichte von Entfremdung und Entwurzelung.
Dieser Text ist Teil der dis:orient-Kolumne des:orientierungen, die jeden zweiten Freitag erscheint.
Die beißenden Sonnenstrahlen schlagen auf die Straßen von Berlin, während ich Ende Juni 2023 das Gelände zum Afghanistan-Festival von „Goethe im Exil“ betrete. Drachen in den Farben verlorener Kindheiten hängen über dem Innenhof des ACUD-Kunsthauses. Die Sonne scheint die Drachen auf den Boden drücken zu wollen, während die schwüle Luft sie nach oben reißt. In kindlicher Neugier, in Erinnerung an Drachenkämpfe, bei dem Geschick und Glassplitter an den Schnüren über Sieg und Verlust entscheiden, gleite ich mit einem Finger zögerlich über einen der Fäden, an denen die Drachen hängen. Beinahe bin ich enttäuscht, dass ich mich nicht am Faden schneide. Währenddessen finden die nostalgischen Frequenzen von Dawood Sarkhosh‘s Song „Sarzamine Man“ (dt. Mein Land) ihren Weg in mein Trommelfell: „Ohne Obdach, bin ich von Haus zu Haus gewandert. Ohne Dich, sind Lied und Strophen seelenlos“. Ein Zeugnis der Qual der Vertreibung, ein Porträt der Sehnsucht, so lebendig reicht die Tiefe dieser Strophen über die Grenzen des afghanischen Exils hinaus: Eine Scheidung aus Liebe als Inbegriff unfreiwilliger Migration.
Veröffentlicht wurde der Song 1997, kurz nach der ersten Machtübernahme der Taliban. Zu einem Zeitpunkt, an dem der Exodus in und aus Afghanistan seit zwei Jahrzehnten eine der größten Massenvertreibungen seit dem zweiten Weltkrieg darstellte. Der Kunstbetrieb in Afghanistan, welcher zuvor selbst noch in den blutigen Aschen des Bürgerkriegs Liebesballaden hervorbrachte, kam spätestens mit den rigiden Verboten der Taliban zum Erliegen. Wer konnte, ergriff die Flucht. Wer es sich im Exil leisten konnte, schuf Kunst.
Die kulturelle Diplomatie des Grenzregimes
Schon immer fühlten sich Kunstschaffende in der Diaspora und im Exil ihren Wurzeln verbunden. Oft spiegeln sie in ihren Arbeiten die sozio-politische Landschaft ihrer Heimat(losigkeit) wider. Doch ihre Beiträge hängen häufig in der Schwebe — manchmal rezipiert, aber oft marginalisiert. Insbesondere, wenn sie nicht als schätzenswerte „intellektuelle“ Exilant:innen gelten, sondern als „unzivilisierte“ Geflüchtete, einschließlich ihrer Nachkommen ab der zweiten Generation.
Zur Wahrheit gehört auch, dass die Verbindung zwischen Exil und Diaspora schon immer durch Ausschlüsse und Barrieren geprägt war. Wer nicht durch Erbe, Status und Prestige hervorsticht - und vor allem nicht gesellschaftlichen Normen des globalen Nordens auf der einen Seite, und der Erwartungen afghanischer auf der anderen Seite entspricht, wird als unwürdig betrachtet.
Der inner-afghanische Elitismus besteht jedoch nicht im Vakuum, er ist auch Ausdruck dafür, wie koloniale Grenzregime im Gewand kultureller Diplomatie selbstevident Räume für Machtgefälle schaffen. Als das Goethe-Institut in Kabul 2017 aufgrund der verschärften Sicherheitslage schließen musste, schob Deutschland weiterhin kurz bis vor der Machtübernahme der Taliban im August 2021 nach Afghanistan ab: Wer es durch Grenzregime schafft, dessen Grad an Nähe zur Elite bestimmt, wer erstklassige, zweit- und drittklassige Kunst betreibt. Alles darunter gilt nicht einmal als Kunst. Die einen werden abgeschoben, die anderen evakuiert.
Als geladene Autorin und Künstlerin auf dem Festival spürte ich einmal mehr die scharfen Kanten dieser Abgründe. Die Hochgeborenen würdigten keines der subalternativen Kunstschaffenden eines Blickes: Mit Minirock, Kopftuch, Selbstgedrehten- und Markenkippen boten wir vor dem Gelände eine Dauerausstellung der Realitäten. Mitmachen erwünscht, Authentizität vorausgesetzt.
Für wen schaffen wir Kunst?
In einer Lesung von Naeema Ghani und Marina Mohammadi wurde eine weitere Ebene des Abgrunds offenbart, allen voran zwischen der ersten und zweiten Generation der Diaspora. Die Autorinnen trugen ihre Kurzgeschichten aus dem Sammelband „My Pen is the Wing of a Bird“ vor. Als Naeema Ghani ihre Kurzgeschichte vorlas, kämpfte ich mit den Tränen. Als Marina Mohammadi an der Reihe war, konnte ich meine Tränen nicht mehr halten. Beide Geschichten, vorgetragen auf Paschtu und Farsi, stellten mit schmerzenden Kinderfüßen in roten Schuhen und der Hoffnung auf eine unentgeltliche Fahrgelegenheit in den harschen Wintern Kabuls die bitteren Realitäten von Armut, Anmut und Leichtigkeit der Sprache dar, in der sie ihre Geschichten erzählten. Es schien sich ein Raum zu öffnen, in dem Heimatlosigkeit auf Geschichten stößt, die einem das Gefühl geben, im Schmerz nicht allein zu sein — ohne vorauszusetzen, dass Emotionen unprofessionell seien. Zeitgleich stieg in mir Panik auf: Ich konnte der Lesung und anschließenden Diskussion folgen, weil ich mir als Kind das Privileg der Literatur erkämpfte. Aber nicht alle hatten die Chance.
Unter dem Publikum identifizierte ich mich selbst - in meinen 30ern - als einer der jüngsten Anwesenden. Die Personen, die in etwa in meinem Alter waren, waren ganz offensichtlich Teil der ersten Generation von Exil und Diaspora. Es folgte eine Diskussion mit Referenzen zur Literaturgeschichte Afghanistans und den Sprachbarrieren Afghanistans: die Kurzgeschichten stünden nicht in der Tradition der Umgangssprache. Völlig übergangen wurde: Um selbst Umgangssprache in geschriebener Form zu verstehen, muss man erst lesen können — in einem Land, in dem der größte Teil der Bevölkerung noch nicht alphabetisiert ist. Das Sprachbarrieren auch in der Diaspora existieren, ebenso. Denn die Abwesenheit derer, die außerhalb des Afghanistans aufgewachsen sind, stand klar im Raum. Auf Simultanübersetzungsangebote zurückzugreifen, während in den Muttersprachen vorgetragen wird, erscheint hier verständlicherweise zu schmerzhaft. Ironischerweise war die schriftliche Form der vorgestellten Werke auf Englisch, was mich dazu veranlasst zu fragen: Für wen schaffen wir Kunst?
Gemeinsamer Schmerz als Ermahnung
In einem Gespräch mit der deutsch-afghanischen Autorin Yasmin Taheri ging die vertraute Angst und ein gemeinsamer Schmerz hervor – die Angst, den Zugang zum kulturellen und intellektuellen Erbe unserer Vorfahren zu verlieren. Sie zitierte Mawlana Rumi Balkhi: „Höre auf die Flöte, wie sie klagt. Sie erzählt von Trennungen.“ Daher habe sie sich entschieden, zu schreiben.
Die Antwort liegt in der Kunst selbst — unserem kollektiven Ausdruck von Schmerz, Sehnsucht, Hoffnung und Widerstandsfähigkeit. Die Brücken liegen in geteilten Erfahrungen, die Kluften und Abgründe überwinden. Dass unser Erbe und alles, was mit und nach uns kommt, nicht zu einem stillen Echo wird, sondern zu einem lebendigen, sich entwickelnden Dialog, der die fragmentierten Teile unserer Identitäten zu einem Teppich webt. Es liegt in der Verantwortung der ersten Generationen und jüngsten Exilwelle, keine exklusiven Clubs zu gründen, sondern Offenheit gegenüber der zweiten Generation zu zeigen und ihre Beziehung zur Macht zu reflektieren. Und es liegt in der Verantwortung der zweiten Generation (und allen danach), dieses Wissen zu kultivieren und Zugänge nicht aufgrund von Selbstgerechtigkeit zu verschließen.
In Teilen fanden Annäherungen zwischen den verschiedenen Generationen im Rahmen des Kulturfestivals statt. Doch damit ist es nicht getan. Die Kunstwelt, um ihrer selbst willen, wenn schon nicht aus Liebe zur Kunst, sollte echte Konsequenzen aus ihrer prekären Lage ziehen. Das Chaos der Evakuierungen 2021 zerstreute eine Vielzahl von Künstler:innen weltweit. Während die Haltung der Taliban zu den Künsten nun ambivalenter erscheint — es finden Kunstausstellungen statt, während Musik verboten ist — befindet sich das kulturelle Leben in Afghanistan weitgehend in einem Zustand des Stillstands, der durch wirtschaftliche Sanktionen und die andauernde Hungersnot verschärft wird. Dass die Kulturproduktion von Afghan:innen von ausländischen Institutionen abhängig ist, weil im Land selbst jegliche Grundlagen fehlen, für die auch der Westen und Deutschland eine Verantwortung trägt, ist Teil der systematischen Tragödie.
Als ich nach dem Festival im berüchtigten Kassel-Wilhelmshöhe strandete, schrieb ich folgende Zeilen in meiner Muttersprache, um meinen eigenen Schmerz zu adressieren: Höre, was die Feder zu beklagen hat: Jede Träne birgt das Gewicht eines Gedichts, ein Ghazal der Liebe, eine Melodie der Fremdheit, eine neugierige Erinnerung, eingehüllt in ein poetisches Rätsel, ein Gedicht von den Legenden, die wir verloren haben. Was uns bleibt, ist das heilige Feuer der Hoffnung.
Mehr Arbeiten der Illustratorin Zaide Kutay finden sich auf ihrem Instagram-Account.