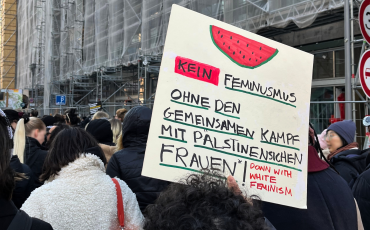Sind Personen, die sich als „of color“ - von Rassismus betroffen - identifizieren, automatisch eine Solidargemeinschaft? Kolumnistin Moshtari Hilal beschreibt die feinen Unterschiede und Privilegien, die das Selbstverständnis und den Blick auf die Welt prägen.
„She is not FOB, is she?” - fragt der befreundete Restaurantbesitzer aus Beirut, der zu Besuch ist, um sich die Biennale in Berlin anzusehen und zeigt dabei auf eine weitere Bekannte mit schwarzem Kurzhaarschnitt, weißen Sneakers, taillierter Jeans und kariertem Mantel. „I mean she doesn't look like fresh off the boat.”
Ich beobachte die Szene wie eine Außenstehende. Plötzlich leuchtet mir der Habitus-Begriff von Pierre Bourdieu ein. Ich habe das entsprechende Werk nicht gelesen, sondern eher beiläufig von dem Begriff erfahren. Er beschreibt, wie verschiedene Arten von Kapital den Menschen formen, also sein Auftreten, seine Sprache, seine Bewegungen, seine Kleidung, sogar seine ästhetischen Vorlieben. Ich spüre meinen Habitus wie kalten Angstschweiß am ganzen Körper und spreche zu mir selbst: Also ist of color nicht gleich of color. Meine Biografie, meine Anpassungsstrategien und das Gefühl der Unangepasstheit werden vor meinem inneren Auge abgespielt. Der heutige Abend fühlt sich wie eine Feldforschung an, Theorie wird physisch erfahrbar.
Anpassung und Unangepasstheit - Wer bestimmt die PASSform?
Ich erinnere mich an meinen naiven Enthusiasmus, als ich von dem afghanischen Windhund erfuhr. Ohne wirklich zu begreifen was kulturelles Kapital war, empfand ich eine gewisse Form von Kultiviertheit oder Stolz durch diesen athletischen, international bekannten Hund. Ich kam plötzlich nicht aus dem Nichts, aus dem Nichts des Asylheims, aus dem man mit Nichts in die wirkliche Welt ging, sondern hatte diesen Hund als Referenz. Meine Familie war Anfang der 90er Jahre aus Afghanistan geflüchtet, sodass ich mit zwei Jahren nichts anderes kannte als Essensgutscheine und die kulturelle Isolation eines „Flüchtlingsschiffes" am Rande der Stadt. Ich war jenes Kind aus dem Flüchtlingsschiff als ich diesen athletischen Hund entdeckte, mit dem ich meine Herkunft teilte und meine volles Haar, für das ich gelobt und beneidet wurde. Doch dann erfuhr ich, dass der afghanische Windhund seit dem anglo-afghanischen Krieg vom afghanischen Kulturgut zum kolonialen Exportgut wurde und seit den 20ern hauptsächlich und ausschließlich von Briten wegen seiner Haare als Showhund gezüchtet wurde. Was bedeutete das für mich? Wenn ich mich anpasste, bliebe dann von mir auch nicht mehr als mein volles Haar?

Bild von einem Showafghanen. Foto von Jurriaan Schulman, https://de.wikipedia.org/wiki/Afghanischer_Windhund#/media/File:Afghan-H..., CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Diese Spannung zwischen dem Versuch der Anpassung und dem Gefühl der Unangepasstheit war durch viele Dinge begründet. Zum einen will man, vor allem als Kind und Heranwachsende, nicht auffallen - sondern durch die Anpassung sozial aufsteigen. Auf der anderen Seite bedeutete Anpassung meist Assimilation, also die Auslöschung des selbst im Versuch sozial aufzusteigen. Ich war mit einer vereinfachenden gesellschaftlichen Dichotomie aufgewachsen, die all meine Wahrnehmung und Handlungsräume in Wir und Die strukturierte. Damit war mein Handlungshorizont auf Anpassung oder Unangepasstheit beschränkt. Zu Beginn umfasste dieses Wir lediglich meine Familie und Verwandtschaft - allesamt Menschen, die mir als Tellerwäscher*innen, Reinigungspersonal, Elektriker*innen, Pizzalieferant*innen oder ohne Arbeit bekannt waren. Wir trugen Kleidung vom Roten Kreuz und Flohmärkten und nannten es nicht Vintage. Wir machten regelmäßig Picknicks und besuchten einander zuhause, darauf beschränkte sich unser sozialer Raum. Als junges Kind war mir die Vergangenheit meiner geflüchteten Verwandten als Lehrpersonal, Ingenieur*innen, Diplomat*innen oder Musiker*innen nicht bekannt. Ich kannte nur das Wir und Die. Dementsprechend erinnere ich mich an meinen ersten Besuch im Museum, im Restaurant oder bei weißen Freunden mit Eigentum und Großeltern sehr gut. Ebenso erinnere ich mich gut an meine erste Begegnung mit Freundinnen, die aussahen wie Verwandte, aber studierten und Lars von Trier Filme kannten.
Und jene Begegnungen mit Kunstinteressierten schwarzbehaarten Freundinnen waren biografisch bahnbrechende Erlebnisse, weil sie die einfache Dichotomie aufbrachen. Ich war aber dennoch verwundert darüber, wie einfach und selbstverständlich sich einige Menschen in bestimmten Räumen bewegten und wie unmöglich es für andere wie mich erschien. Auch wenn ich lernte die Dichotomie zu durchschauen, blieben Unterschiede, die uns formten. Es gab jene Menschen, die von klein auf wussten wie sie einen Ort zu betreten, ihre Körper beim Essen im Restaurant zu bewegen, ein Gemälde zu betrachten oder eine Zeitung zu lesen hatten, so ganz selbstverständlich. Und dann gab es die anderen, wie mich, die es mühselig lernten. Jene, die glauben mit dem Griff nach dem falschen Besteck entlarvt zu werden.
Wer isst Tofu mit Kokosnusscreme?
Als nun jener Unternehmer aus Beirut am Kleidungsstil und an der selbstbewussten Bewegungsfreiheit ihres Körpers und ihrer Mimik ablas, dass die Bekannte nicht FOB ist, also fresh off the boat, fragte ich mich, was denn mein Körper und meine Sprache über mich aussagen. Wenn man mir die zuvor geschilderte Biografie ansieht, bin ich wohl daran gescheitert, mich als ein kultivierter und lässiger Jemand zu geben, der ganz selbstverständlich hybride vietnamesische Küche zu Abend isst und gleichzeitig über die Gentrifizierung spekuliert. Werde ich entlarvt werden?
Wir, das bedeutet ich und meine Bekannten aus Beirut und Teheran, die nicht FOB sind, essen gemeinsam in Kokosnusscreme eingelegtes Tofu, umrahmt von getrockneten Rosenblättern und sprechen über den Umgang der deutschen Mehrheitsgesellschaft mit Menschen wie uns, den Dunkelhaarigen, Braunen oder wie auch immer nicht-Weißen. Eine von ihnen spricht von ihrem Arbeitgeber in einem renommierten Architekturbüro, in dem sie arbeitet seit sie für ihre Karriere aus Teheran nach Berlin gezogen ist. Er sei rassistisch, weil er abfällige Dinge über Geflüchtete sage, aber gleichzeitig ihr versichere, dass sie eine gute Ausnahme sei, eine gute Ausländerin. Das sei so unausstehlich und rassistisch, deshalb überlege sie, ob sie dort noch arbeiten wolle. Ich überlege, wie Menschen, die hierher geflüchtet sind oder hier geboren sind teilweise keine Wahl haben, wenn Arbeitgeber*innen, Ärzt*innen, Lehrer*innen oder Polizist*innen sie rassistisch behandeln. Das Leben als sichtbare Minderheit in Deutschland ist für viele keine Wahl oder die einzige Wirklichkeit, die sie kennen. Es muss anders sein in der Sprache der eigenen Eltern studiert zu haben, es muss anders sein als Ausländer*in behandelt zu werden im Ausland, während andere als Ausländer*in behandelt werden im einzigen Land, in dem sie jemals gelebt haben. Ich frage mich inwiefern die Wahl, das optionale Leben in oder Einreisen nach Berlin bereits soziales, ökonomisches und kulturelles Kapital voraussetzt, das sie besitzt, jene Geflüchtete oder auch in Neukölln geborene Menschen aber nicht.
Was sagt „of color” aus und was verschweigt es?
Identitätspolitik kann dazu führen, dass sich Freundinnen, die sich gegenseitig als „of color” bezeichnen, also von Rassismus Betroffene, zusammensetzen, um einander von ihren Traumata zu erzählen um sich verstanden zu fühlen. Die eine erzählt von Misshandlung, von Ratten in ihrer Wohnung und Mobbing. Davon, dass sie von ihrer Familie verstoßen wurde aufgrund ihrer Sexualität, und dass sie sich nie versöhnen werden, weil sie durch ihre Bildung nicht mehr die Sprache ihrer Eltern spreche. Die andere nickt verständnisvoll und bejaht mit: „Mir hat auch einmal jemand gesagt, dass ich nach Curry stinke“, und schreibt währenddessen eine Nachricht auf Englisch an ihre Mutter, die ein Landgut besitzt.
Angstschweiß als Habitus
Der Habitus, der vorrangig von der sozialen Klasse, also den ökonomischen Grundvoraussetzungen für die soziale Erfahrung, bestimmt wird, strukturiert nicht nur die Welt um uns herum, sondern auch uns selbst. Unser ganzes Auftreten ist die Summe unserer sozialen Erfahrungen. Wir können Verhaltensstrategien entwickeln, um sozial aufzusteigen, aber das kostet und bedeutet eine andere Form von Energie und gar Selbstverleugnung (Assimilation), als bei jemandem der sowohl ökonomisches als auch kulturelles, soziales oder symbolisches Kapital besitzt. Dabei bilden etwa studierte Eltern, die einwandfreie Kenntnis der eigenen Muttersprache oder die Jugend in einer Mehrheitsgesellschaft, die einen Menschen nicht ästhetisch oder kulturell ausgegrenzt hat, eine Form von Kapital, die wir auch benennen und als Privilegien anerkennen müssen. Mein Angstschweiß ist also keine Scham, sondern eine Erkenntnis und sie tritt an der Stelle aus, an der Begriffe wie „of color” verstummen.
Die Bollywood Schauspielerin Priyanka Chopra, die mittlerweile auf dem US-amerikanischen Markt ebenfalls große Erfolge feiert, hatte sich auf der Titelseite des Magazins Condé Nast klar positioniert. Der Aufdruck auf ihrem Oberteil zeigt deutlich, dass sie weder eine Geflüchtete, eine Migrantin, noch ein Outsider sei, denn mit ihrem Kapital kann sie sich selbst nur als „Traveller”, also Reisende identifizieren. Diese Form der Selbstpositionierung oder Benennung ökonomischer Unterschiede meine ich allerdings nicht, wenn ich von der Benennung der eigenen Privilegien spreche. Stattdessen geht es mir vielmehr darum, selbstreflektiert zu sein und einzuschätzen, wann die eigene Diskriminierung eine Rolle spielt und wann sie eventuell zu einem Werkzeug wird, um Zugang zu Gruppen, Sympathie oder kommerzieller Aufmerksamkeit zu erhalten. Nicht jede „Person of Color” ist in der Position, um sich über jede Form von Rassismus oder Migration oder Krieg, den Islam oder Flucht zu äußern. Und nicht jede „Person of Color” hat eine traumatische Fluchterfahrung, deshalb ist ein Beiruti Hipster, der andere anhand ihres Aussehens als FOB oder nicht, also geflüchtet, marginalisiert, im Prekariat lebend oder nicht, beurteilt vielleicht nicht rassistisch, aber menschenverachtend.