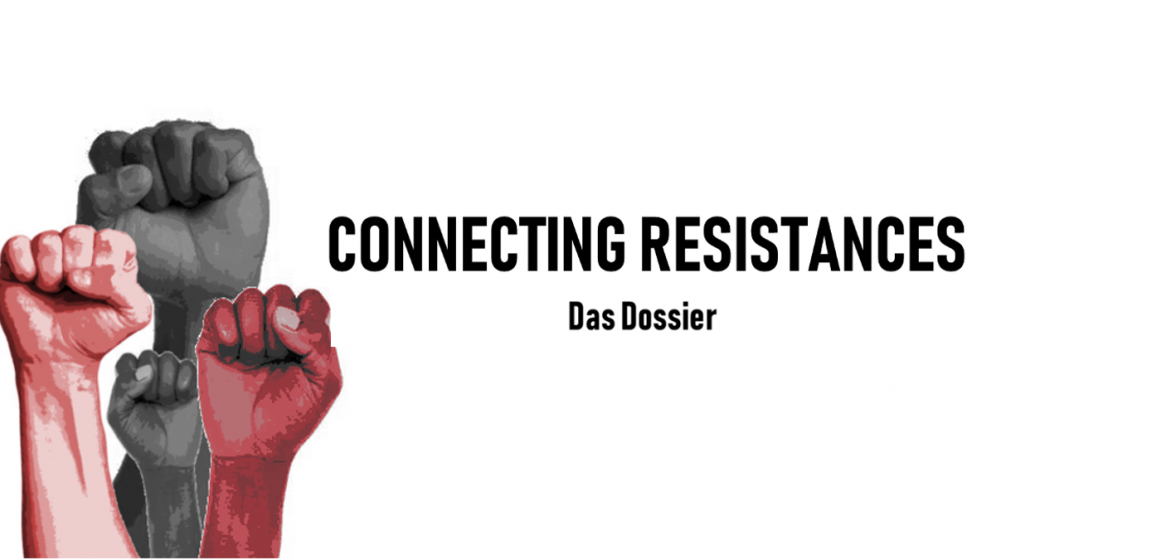„Connecting Resistances“ hat einen wertvollen Austausch angestoßen – über Ländergrenzen und die Gräben zwischen akademischer und aktivistischer Arbeit hinweg. Das haben alle Teilnehmer*innen betont. Jetzt geht es darum, wie weiter miteinander gesprochen wird – und worüber.
„Haybat al-dawla“, so wird in vielen Ländern Nordafrikas und Westasiens (WANA) die „Unantastbarkeit des Staates“ beschrieben. Damit versuchen sich staatliche Akteure zusammen mit ihren Geschäftspartnern im In- und Ausland der Kritik zu entziehen – und gleichzeitig zu „rechtfertigen“, dass sie mit aller Härte gegen jede Kritik vorgehen.
Dieses Prinzip des neoliberalen Autoritarismus ist über Jahre gewachsen. Langsam aber beginnt es zu bröckeln, weil vielerorts für soziale Gerechtigkeit gekämpft wird, wie die Teilnehmer*innen von „Connecting Resistances“ berichteten. Den Austausch darüber zu unterstützen, war deshalb auch das Ziel der Konferenz.
Wie ermutigend und wertvoll dieser Austausch ist, betonten alle Beteiligten, gerade weil es so viele Hindernisse dafür gibt. Obwohl Repressionen und Gewalt weiterhin auf der Tagesordnung stehen, verbreitete sich deshalb unversehens Zuversicht: Auf persönliche Weise tauschten sich die Teilnehmer*innen darüber aus, was sie in ihrer politischen Arbeit gerade am meisten beschäftigt – und beratschlagten, wie sie sich dabei konkret unterstützen können.
Über Grenzen ...
Der Versuch, gemeinsam Grenzen zu überwinden und Blasen aufzulösen, begann schon vor vielen Monaten. Bei knapp 50 Teilnehmer*innen aus über 20 Ländern war das ganze Unterfangen auch eine große finanzielle und logistische Herausforderung.
Es musste ein geeigneter Tagungsort gefunden und Simultanübersetzung organisiert, zahlreiche Visaanträge gestellt und aufwendige Reiserouten geplant werden. In einzelnen Fällen hat das leider nicht geklappt, allen Bemühungen zum Trotz. Bei einer syrischen Aktivistin, die in der Türkei lebt, stellten sich die deutschen Behörden zum Beispiel quer. Eine jemenitische Aktivistin erhielt nach langem Bangen zwar ein Visum, musste ihre Teilnahme dann krankheitsbeding aber leider absagen. Andere Teilnehmer*innen befürchteten derweil, aufgrund ihres politischen Engagements bei der Aus- oder Einreise festgehalten zu werden.
Doch die Angst vor autoritärer Politik reicht bis nach Deutschland: Aus Sorge vor Beobachtung und Zugriffen ihrer Botschaft in Berlin, baten insbesondere ägyptische Teilnehmer*innen um Anonymität. Abgesehen von der öffentlichen Abschlussveranstaltung, fand die Konferenz daher hinter geschlossenen Türen statt. Angesichts von „shrinking spaces“, wie die zunehmende Einschränkung zivilgesellschaftlicher Handlungsspielräume umschrieben wird, ist damit aber ein sicheres Umfeld geschaffen worden, in dem sich die Teilnehmer*innen vertrauensvoll austauschen konnten.
... und Blasen hinweg
Die Frage, wie sich politischer Aktivismus und kritische Wissenschaft dabei gegenseitig unterstützen und in ihrer Arbeit ergänzen können, war ein besonderes Anliegen. So sollte neben der Kontaktaufnahmeauch die weitere Zusammenarbeit inhaltlich und strategisch geschärft werden. Das Spannungsfeld zwischen aktivistischer und akademischer Arbeit wurde daher bereits im Vorfeld aufmerksam diskutiert.
Einerseits gibt es zahlreiche Verbindungspunkte zwischen politischem Aktivismus und kritischer Wissenschaft. Denn nicht nur sind sie zunehmend den Anforderungen und Zwängen des Marktes unterworfen, in Deutschland ebenso wie den Ländern in Nordafrika und Westasien. Beide Bereiche, so verschieden sie auch sein mögen, verbinden oft auch gemeinsame Ziele: Beide beschäftigen sich mit bestehenden Ungerechtigkeiten und möchten dazu beitragen, diese zu überwinden. Sich dabei gegenseitig zu unterstützen, ist daher Teil eines dezidiert politischen Anliegens, das durch Formate wie „Connecting Resistances“ auch in Zukunft gestärkt und ausgebaut werden soll.
Andererseits verbleibt oft eine Kluft zwischen wissenschaftlicher und aktivistischer Arbeit. Werden doch gerade durch wissenschaftliche Arbeit immer wieder genau jene Hierarchien bestätigt, die politischer Aktivismus abzutragen versucht. Diese Hierarchien sind materieller und immaterieller Art: Dabei geht es um umkämpfte ökonomische Ressourcen ebenso wie symbolisches Kapital; um den Zugang zu diesen Ressourcen ebenso wie den Anspruch, stellvertretend für/über andere Menschen zu sprechen.
Weil globale Verteilungskonflikte also unmittelbar mit Fragen politischer Repräsentation verbunden sind, hat die Konferenz genau an dieser Schnittstelle angesetzt: Um gemeinsam für soziale Gerechtigkeit einzustehen, wurden bewusst Aktivist*innen eingeladen, die in wissenschaftlichen Kreisen sonst kaum vertreten sind.
Doch wie lief das im Detail? Welche Grenzen verbleiben eventuell, auch wenn sie überwunden werden sollen? Und was sagen die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, für die nächsten Schritte von „Connecting Resistances“ aus? Wie wichtig es ist, miteinander zu sprechen, haben schließlich alle Teilnehmer*innen betont – jetzt also geht es darum, wie genau und worüber. Zwei inhaltliche Ansatzpunkte dafür sind die anhaltende Auseinandersetzung mit politischer Ökonomie und identitätspolitischen Grabenkämpfen.
Politische Ökonomie ist mehr
Keine Frage, die politische Auseinandersetzung um soziale Gerechtigkeit wird maßgeblich durch ökonomische Rahmenbedingungen beeinflusst. Das hat Angela Joya, Assistenzprofessorin für internationale Studien und Ökonomie der University of Oregon, in ihrer Keynote mit dem Titel „What has Capitalism got to do with it“ ausführlich erläutert.
Internationale Finanzinstitutionen stehen dabei an vorderster Stelle – und das seit Jahren. So beeinflussen sie, bestimmen gar, nicht nur die „Entwicklungspotentiale und -ziele“ der Länder Nordafrikas und Westasiens. Durch technokratische und marktkonforme Einflussnahme beschränken und entpolitisieren sie auch die Formen und Inhalte aktivistischer Arbeit.
Über „Investitionsprogramme“, insbesondere in der Rüstungsindustrie, sind auch nationale Regierungen in sozio-politischen Entwicklungen im Ausland involviert. Das betrifft, wie der ehemalige Bundestagsabgeordnete Jan van Aken unmissverständlich betont hat, auch die deutsche Regierung. Zugunsten von Wirtschaftsabkommen nimmt sie immer wieder Menschenrechtsverletzungen in Kauf.
Durch die kritische Auseinandersetzung mit politischer Ökonomie können wissenschaftliche und aktivistische Arbeiten auf diese Machenschaften und ihre Auswirkungen hinweisen und einwirken – sie müssen es sogar, so der Tenor der Konferenz.
Gleichzeitig – und das war vielen Teilnehmer*innen ein großes Anliegen – dürfen andere, vermeintlich weniger offensichtliche Aspekte der politischen Ökonomie nicht vernachlässigt werden. Insbesondere in der wissenschaftlichen Beschäftigung betrifft das tiefsitzende Hierarchien von Dominanz und Signifikanz, die sich in der Wissensproduktion und -weitergabe mit dem „Nahen Osten“ reproduzieren. Dabei beeinflussen rassistische, sexistische und klassistische Hierarchien, wer über wen spricht, wer nicht spricht, wer gehört wird und wer nicht – und damit auch, wessen Hoffnungen, aber auch wessen Leid überhaupt Bedeutung beigemessen wird.
Eine Antwort auf diese Hierarchien, das wurde bei der Konferenz deutlich, liegt jedoch nicht in der Konstruktion eines simplen Gegensatzes von „hier“ und „dort“. Denn weder soll Autorität „von außen“ pauschal diskreditiert, noch Lokalität romantisiert werden. Bei „Connecting Resistances“ geht es schließlich nicht nur darum, wer etwas sagt, sondern auch zu welchem Zwecke: Die anhaltende Auseinandersetzung um soziale Gerechtigkeit, so kann deshalb festhalten werden, ist ein geteiltes Anliegen zwischen Deutschland und der WANA-Region, zu dem Menschen aus nah und fern beitragen können.
Die Fallstricke der Identitätspolitik
Gewalt, davon wurde während der Konferenz viel gesprochen, gibt es in vielen unterschiedlichen Formen und Ausprägungen. Neben physischer Gewalt, wie sie nicht zuletzt durch deutsche Rüstungsexporte befördert und durch offizielle Kooperationen zu „organisierter Gewalt“ wird, sind auch Ausgrenzungspraktiken gewaltvoll, egal ob strukturell, kulturell oder symbolisch verfasst. Das resultiert in der (relativen) Abwesenheit bestimmter Personen, Positionen und Perspektiven, die jedoch erst sichtbar gemacht werden muss.
Für die Konferenz wurden deshalb einzelne Themen gesondert behandelt. Neben der Arbeit der „Alliance of Migrant Domestic Workers in Lebanon“ zählt dazu insbesondere die Notsituation im Jemen. Doch diese Themen und ihre Vertreter*innen sehen sich hartnäckigen Aufmerksamkeitsökonomien ausgesetzt: „Syria, let Yemen speak,“ bat eine Teilnehmerin denn auch einen Teilnehmer, der eine Diskussion mit seinen Beiträgen dominierte.
Diese Aussage offenbart ein grundlegendes Problem: Wie nämlich kann mit Ausgrenzung umgegangen werden, ohne dabei unterschiedliche Sensibilitäten, Bedürfnisse und auch Aufmerksamkeiten gegeneinander auszuspielen? Eine Antwort darauf können Praktiken kultureller Anerkennung bieten. Schwache, marginalisierte und bedrohte Positionen sollen sich dabei aktiv ermächtigen; ihnen wird bewusst Raum dafür gegeben. Mit affirmativen Aktionen also gegen strukturelle Ungerechtigkeit? Ja, unbedingt!
Aber gleichzeitig bieten solche identitätspolitischen Ansätze auch viele Fallstricke. Im Zuge der Konferenz wurde das gerade mit Blick auf das Thema „Privilegien“ deutlich. Bei der öffentlichen Abschlussveranstaltung und Podiumsdiskussion beanstandete zum Beispiel eine Besucherin, dass nicht nur viele akademische, sondern auch aktivistische Debatten zu elitär seien – und deshalb keine Solidarität mit „Arbeitern und Bauern“ entstehen könne. Dafür gab es direkt viel Zustimmung.
Nadje al-Ali, Professorin für Gender Studies an der „School of Oriental and African Studies“ der Universität London, mahnte anschließend dennoch etwas mehr Genauigkeit an. Es sei zu einfach, eine binäre Konfrontation zu entspinnen, wonach People of Color automatisch unterprivilegiert und weiße Menschen demnach privilegiert seien. Dabei würden unterschiedlichen Menschengruppen nicht nur einheitliche Eigenschaften zugeschrieben werden. Diese Eigenschaften würden auch strategisch in „gut“ und „böse“ aufgeteilt. Durch solch kulturessentialistische Vereinnahmung, sozusagen eine Art „Orientalism in reverse“, lasse sich Ausgrenzung jedenfalls nicht begegnen.
Denn während dadurch Gräben geschlagen werden, wo nicht zwangsläufig welche sein müssen (Stichwort: „hier“ und „dort), bleiben andere Differenzen außen vor, die vermeintlich weitreichender sind (soziale Klassen zum Beispiel). Starke Allianzen zu knüpfen, wird dadurch erschwert.
Ein Ansporn für die Zukunft
Dabei sollte es genau darum gehen, da waren sich alle Beteiligten einig. „How to reach more people, outside of the small circle of political activists,“ fragte ein Teilnehmer aus dem Libanon.Dass diese Frage zum Abschluss der Konferenz kam, ist deshalb vor allem ein Ansporn für die Zukunft. Über zwei sehr volle Tage wurde bereits intensiv diskutiert. Dabei sind viele wertvolle Fragen und Gedanken aufgeworfen worden, insbesondere über politische Ökonomie und Identitätspolitik.
Diese Fragen lohnt es weiterzuverfolgen, um eine gemeinsame Sprache zu finden und Handlungsoptionen zu erschließen. Wie das in akademischer und aktivistischer Arbeit zwischen Deutschland und der WANA-Region gehen kann, haben alle Beteiligten im Laufe der Konferenz auf inspirierende Weise vorgemacht: Das erfordert, Gespräche zu suchen, zunächst aber auch aufmerksam zuhören zu können, bevor man selber zu sprechen beginnt; sich und das eigene Wissen nicht zu überschätzen, sondern in die Lage anderer Menschen zu versetzen; ihnen eine Stimme zu lassen und deren Kampf nicht zu vereinnahmen, auch wenn „wir“ ihn unterstützen wollen; Prinzipien – und nicht nur Interessen – zu betonen, begründen und auch zu verteidigen; und Kämpfe gegen neoliberalen Autoritarismus weise zu wählen, um starke Allianzen für soziale Gerechtigkeit zu bilden.