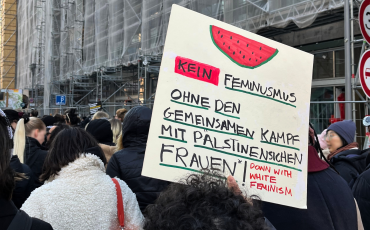Ein internes Maßnahmenpapier zeigt, wie die Polizei sogenannte arabische Familienclans bekämpfen will. Dabei nutzt sie rassistische Stereotype, um eine ganze Bevölkerungsgruppe unter Generalverdacht zu stellen, findet Hannah El-Hitami.
Generalverdacht. Laut Duden ist das ein „schon ohne konkrete Anhaltspunkte generell gehegter Verdacht“. Unter eben jenen werde die Polizei dieser Tage gestellt, glaubt Innenminister Horst Seehofer (CSU), wenn breite Teile der Gesellschaft eine Studie zum Rassismus in den Sicherheitsbehörden fordern.
Während man der Polizei gegenüber keinen Verdacht hegen soll – trotz Munitionslagern, Drohbriefen an Politiker*innen, Feindeslisten, Hakenkreuz-Schmierereien, NSU-Versagen und mittlerweile offenkundiger Vertuschungen im Fall Oury Jalloh – scheint die Polizei selbst kein Problem damit zu haben, andere Menschen unter Generalverdacht zu stellen. Jedenfalls dann nicht, wenn es darum geht, ihren liebsten Feind zu bekämpfen: den arabischen Clan.
Diesen Eindruck erweckt ein Maßnahmenpapier der Polizei in Essen, in dem von einer „notwendigen Kollektivbetrachtung“ die Rede ist: „Auf eine stetige Abgrenzung zwischen Clan-Mitgliedern, die kriminell in Erscheinung getreten und solchen, die es nicht sind, muss an dieser Stelle verzichtet werden“, heißt es in dem internen Papier, über das Die Welt und neues deutschland diese Woche berichteten.
Begründet wird die rassistische Pauschalisierung so: „Zum einen, weil grundlegende Denkmuster häufig auch bei Familienmitgliedern verankert sind, die nicht kriminell auffällig sind, und zum anderen, weil auch bei Kenntnis über Kriminalität einzelner Familienmitglieder der Rest schweigt.“ Klingt fast so wie der kameradschaftliche Zusammenhalt bei der Polizei Essen, der ermöglichte, dass über lange Zeit rechtsextreme Chatgruppen bestehen konnten, die diese Woche aufgedeckt wurden.
„Freiheiten nehmen“
Doch zurück zum Maßnahmenpapier: Obwohl in den vergangenen Monaten viel über rechtsextreme Netzwerke in der Polizei berichtet wurde und Racial Profiling seit Jahren immer wieder in der Kritik steht, schockiert ein Dokument wie dieses umso mehr, weil es die Systematik und vermeintliche Wissenschaftlichkeit von rassistischem Vorgehen innerhalb der Polizei belegt. Das Maßnahmenpapier inspiriert und legitimiert Rassismus – vor allem vor dem Hintergrund, dass es nd-Berichten zufolge von Dorothee Dienstbühl verfasst wurde, die als Professorin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW für die Ausbildung von Nachwuchspolizist*innen verantwortlich ist.
Dienstbühl hat sich in dem Papier eine ganze Palette an polizeilichen Maßnahmen überlegt, mit der man Kriminelle und ihre gesamte Familie „treffen“ kann: „vorhandenes Misstrauen in die eigene Community stärken“, „Verletzung und Schwächung der Männlichkeit (insbesondere auch durch Frauen)“, „Geld und Luxusartikel nehmen, Ressourcen schrumpfen“, „Freiheiten nehmen“. Der Kampf der Polizei gegen den „Clan“ klingt hier weniger nach einem sachlichen und gesetzeskonformen Vorgehen als nach einem persönlichen Rachefeldzug. Der Ausdruck „insbesondere auch durch Frauen“ sticht ins Auge. Die Verfasserin erklärt: Durch entsprechend aggressives Auftreten könnten weibliche Beamte „den Mann dominieren“ und in seiner Ehre „verletzen“.
Dienstbühl, die migrantische Familien hier und in anderen Interviews als Sinnbild einer patriarchalen Machokultur darstellt, empfiehlt der Polizei nun selbst Frauen zu instrumentalisieren, um diese Typen mal so richtig zu demütigen. Übertroffen wird das wohl nur noch von ihrem daran anschließenden Vorschlag, weitere Behörden wie Jobcenter, Ordnungsamt, Finanzamt, Zoll und Jugendamt einzubinden, um „Clan“-Angehörigen das Leben in allen Bereichen schwer zu machen. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) findet: „Das macht eigentlich den Pfiff aus bei der Sache. Dass alle gemeinsam unterwegs sind und an ganz, ganz, ganz vielen Stellen Nadelstiche setzen, Unruhe verbreiten.“
Weiße Gewalt legitimieren
Es soll hier gar nicht darum gehen, ob es organisierte Kriminalität gibt und ob daran auch Familien mit Migrationshintergrund beteiligt sind. Das ist bestimmt so. Ein Riesenproblem liegt aber in der tiefsitzenden, rassistischen Überzeugung, nicht nur bei der Polizei, dass bestimmte Arten von Menschen besonders gefährlich seien. Die stereotype Vorstellung, dass vermeintliche Angehörige bestimmter Familien oder „Kulturkreise“ allesamt gleich ticken und unter einer Decke stecken, zeigt sich in Dienstbühls Maßnahmenpapier wohl nirgendwo deutlicher als in dem Vorschlag, bei Einsätzen von Polizei und Zoll Hundestaffeln einzusetzen, da „Clan“-Mitglieder sich vor Hunden fürchteten und diese als „unrein“ betrachteten.
Barbarisch, gewalttätig, hypermaskulin: so fantasiert sich Europa einen typischen Araber schon seit Jahrhunderten zusammen. Immer wieder werden derartige Vorurteile geschürt, um die Gewalt weißer Menschen zu legitimieren, sie rational und wissenschaftlich wirken zu lassen. Barbarisch, gewalttätig, hypermaskulin: wie wäre es wohl, wenn Dienstbühl einmal ihre eigenen Kollegen durch diese Brille sehen würde?
Wenn Dienstbühl darauf angesprochen wird, dass die Kriminalitätsstatistik eigentlich eine verhältnismäßig geringe Gefahr durch „Clans“ suggeriert, verweist sie auf die abstrakte Gefahr (man könnte auch sagen, die eingebildete, die ideologisch motivierte): Es gehe „um das Beherrschen des öffentlichen Raums, in dem Clans gewalttätig auftreten“, sagte Dienstbühl vor einigen Monaten in einem Interview mit der Berliner Zeitung.
Auf eine „Machtdemonstration“ und einen „Eroberungsanspruch“ der Clans, wie er in öffentlich ausgetragenen „Blutfehden“ Ausdruck finde, müsse die Politik reagieren. Eine gefährliche Strategie: Bietet der, gegen den man vorgehen möchte, durch seine Taten nicht ausreichend Anlass dazu, so muss man dessen Gewaltpotential eben umso mehr betonen. Um tatsächliche Kriminalität geht es der Polizei dann nur noch sekundär, sondern vielmehr darum, das Feindbild eines Arabers zu konstruieren, der zu allem fähig sein könnte. Dessen Bürgerrechte erlaubt sich der Staat dann schon vorsorglich zu beschneiden.